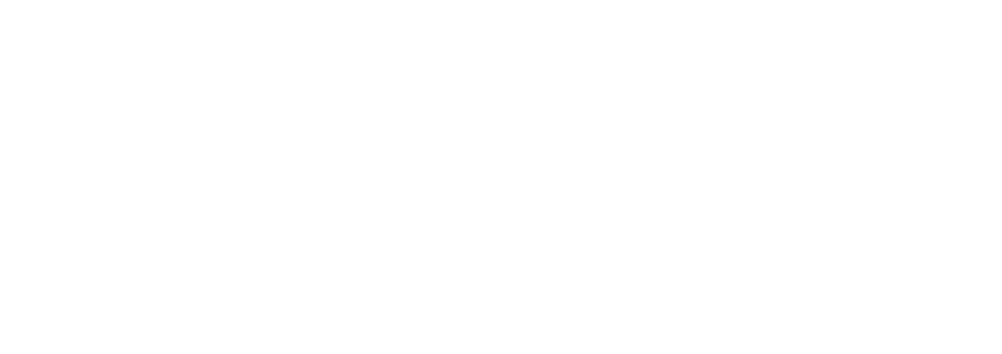Max Mannheimer
Max Mannheimer wurde am 6. Februar 1920 in der tschechoslowakischen Stadt Neutitschein (Nový Jičín) geboren. Er verbrachte dort seine Kindheit und Jugend in der Kaufmannsfamilie von Jakob und Margarethe Mannheimer. Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht 1938 sah sich die Familie gezwungen, in den noch nicht besetzten Teil des Landes umzuziehen nach Ungarisch-Brod, dem Geburtsort der Mutter. Doch auch hier war die Familie vor der nationalsozialistischen Verfolgung nur wenige Wochen geschützt und Mannheimer musste schon bald Zwangsarbeit im Straßenbau leisten.
Am 27. Januar 1943 wurde Max Mannheimer, der nur wenige Monate zuvor Eva Bock geheiratet hatte, gemeinsam mit seinen Eltern und Geschwistern über das Ghetto Theresienstadt in das Konzentrations-und Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Mannheimers Frau, seine Eltern, seine Brüder Erich und Ernst sowie die Schwester Käthe wurden dort ermordet.
Nach anderthalb Jahren Gefangenschaft im Stammlager Auschwitz wurden Max Mannheimer und sein jüngster Bruder Edgar im August 1944 über das KZ Warschau in das KZ Dachau deportiert, wo sie in den Außenlagern Karlsfeld und Mühldorf ebenfalls unter furchtbaren Bedingungen Schwerstarbeit leisten mussten. Als das Lager Mühldorf am 28. April 1945 aufgrund des Heranrückens alliierter Truppen evakuiert werden sollte, wurden die Häftlinge gezwungen, in einen Zug mit unbekanntem Ziel zu steigen. Am 30. April wurde Mannheimer in der Nähe von Tutzing am Starnberger See von Einheiten der US-Armee befreit. Er war zu diesem Zeitpunkt stark unterernährt und von der KZ-Haft schwer gezeichnet.
Nach der Befreiung kehrte Max Mannheimer zunächst in seinen Geburtsort in die Tschechoslowakei zurück. Dort begegnete er der engagierten Sozialdemokratin Elfriede Eiselt. Mannheimer und Eiselt wurden ein Paar und entschlossen sich nach der Heirat 1946 für ein Leben in Deutschland. Viele Jahre lang arbeitete Max Mannheimer in München als Angestellter bei verschiedenen jüdischen Organisationen und veröffentlichte im Jahr 2000 seine, bereits in den 1970er Jahren verfassten Erinnerungen unter dem Titel „Spätes Tagebuch“.
Seit den 1980er Jahren nahm Mannheimer als Zeitzeuge an der Internationalen Jugendbegegnung in Dachau teil und berichtete seitdem Tausenden von Jugendlichen von seiner Verfolgung während der NS-Zeit.
Nachdem sich Max Mannheimer auch für die Errichtung des Jugendgästehauses in Dachau eingesetzt hat, vertrat er seit 1988 die „Lagergemeinschaft Dachau“ im Beirat der 1998 gegründeten „Stiftung Jugendgästehaus Dachau“. Er engagierte sich nahezu unermüdlich für die Bildungs- und Erinnerungsarbeit vor Ort, so dass die Einrichtung sein Engagement 2010 mit der Umbenennung des pädagogischen Bereichs in „Max Mannheimer Studienzentrum“ würdigte.
Max Mannheimer starb am 23. September 2016 in München.
Nach seinem Tod beschloss der Stiftungsvorstand die Umbenennung des Hauses und der Stiftung in „Stiftung Max Mannheimer Haus“.
ben jakov
Max Mannheimer begann in den 1950er Jahren zu malen und signiert mit dem Namen ben jakov (Sohn Jakobs). Eine Hommage an seinen Vater.
Er hat ein umfangreiches, häufig ausgestelltes und facettenreiches Werk geschaffen – Gemälde, Zeichnungen und Kollagen. 1975, 1995, 2001 und 2015 wurden seine Werke in München ausgestellt, 1977 in Zürich, 1992 in seiner Geburtsstadt Nový Jičín, sowie 2000 und 2010 in Dachau. Im Katalog der Ausstellung von 2010 heißt es über Mannheimer: Er male für sich selbst, um des Akts der Entstehung der Bilder. Nicht zuletzt bedeutete diese Tätigkeit auch eine Verarbeitung der furchtbaren Vergangenheit. Die Werke „sind auch Bilder eines Weges aus Schmerz und Depression.“ Er selbst hat einmal gesagt: „Ich male nicht, ich vermähle Farben.“ So vereinen seine Gemälde Farbenfreude mit einer Vielfalt an Formen und Farbmischungen.

Max Mannheimer (1920 – 2016)
Max Mannheimer, Holocaust-Überlebender und Vizepräsident des Internationalen Dachau-Komitees. Ab den 1980er Jahren engagierte er sich aktiv für eine Kultur des Erinnerns und des Gedenkens. Max Mannheimer starb am 23. September 2016 in München. Nach seinem Tod beschloss der Stiftungsvorstand die Umbenennung des Hauses und der Stiftung in „Stiftung Max Mannheimer Haus“.